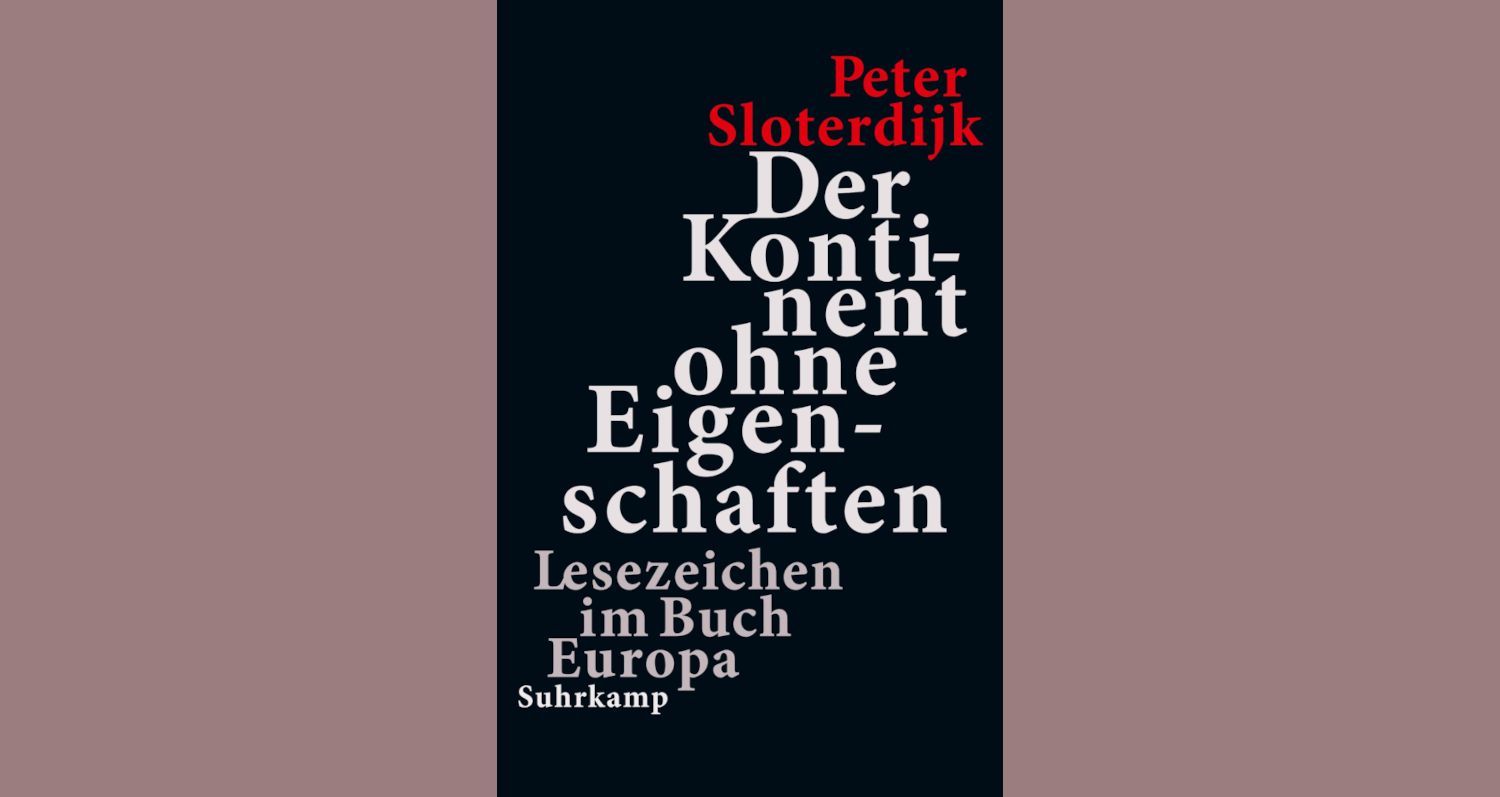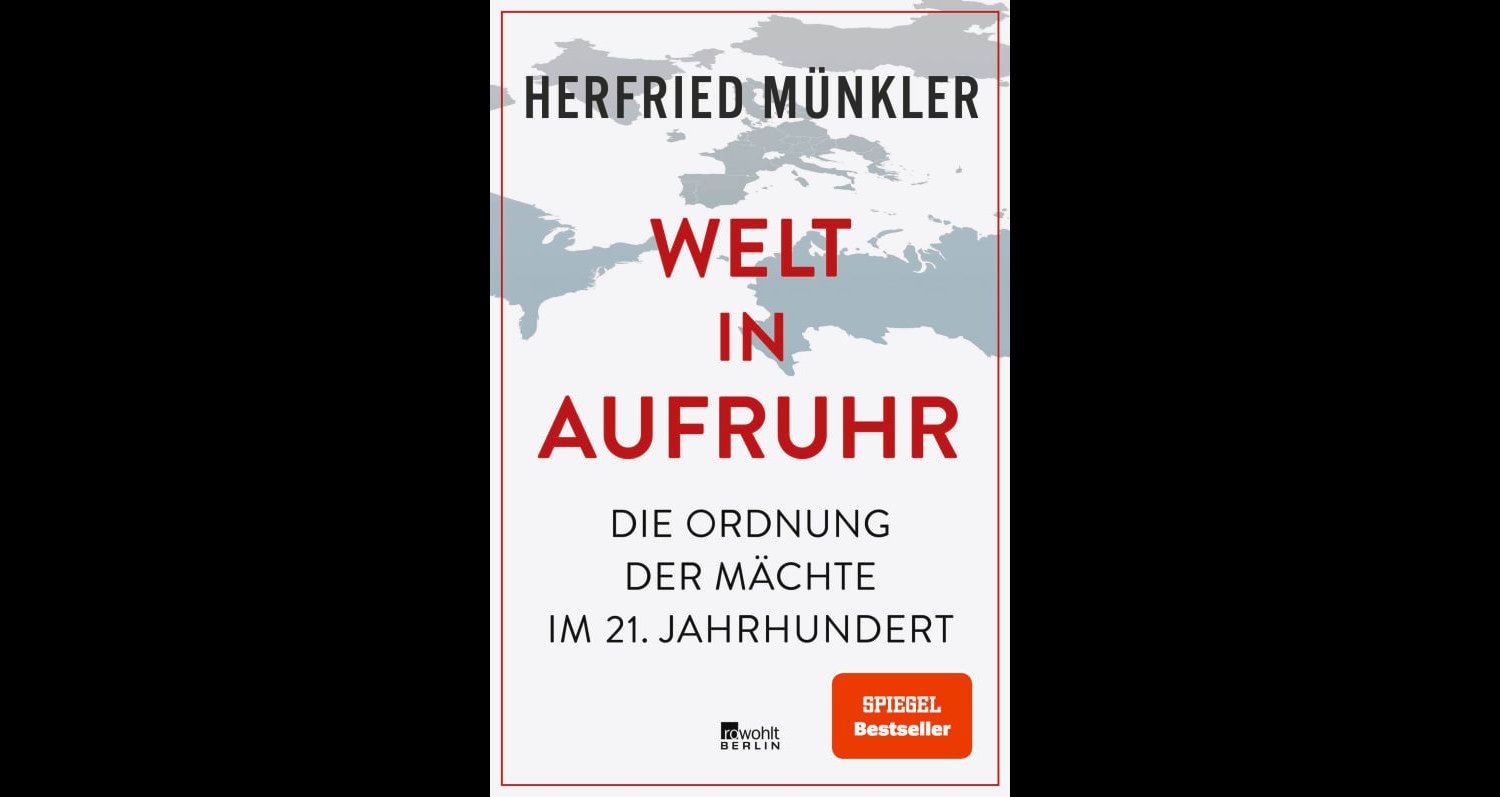Rezension: Herfried Münkler skizziert in seinem neuen Buch das Wünschbare für die geopolitische Zukunft Deutschlands und Europas. Doch ist es auch das Machbare?
Schon bei Herfried Münklers letztem Buch „Welt in Aufruhr“ hatte ich mich darüber gewundert, dass all die Kronzeugen der geopolitischen Welterklärung wie Thukydides, Dante Alighieri und Niccolò Machiavelli, die Münkler auftreten ließ, zwar überaus interessante und bedenkenswerte Analysen geliefert hatten, ihre hoffnungsvollen Vorhersagen jedoch brutal an der Realität gescheitert waren und schöne Illusionen blieben.
Es scheint als ob sich Herfried Münkler mit seinem neuen Buch in diese illustre Gesellschaft einreihen will. Mit großer Akribie analysiert er den Status quo und entwirft ein Geflecht an idealistischen Projektionen und praktischen Handlungsanweisungen. Mit gutem Willen könnte man darin eine vorauseilende Politikberatung für den kommenden Kanzler Friedrich Merz sehen. Eine Skizze, die einen idealen Horizont abbildet, der grobe Orientierung geben soll. Machiavellis „Il principe“ diente einem ganz ähnlichen Zweck.
Doch während man Herfried Münklers Generalabrechnung in diesem dicken Buch folgt, beschleicht einen immer mehr das Gefühl, dass das, was er fordert, zwar durchaus wünschenswert wäre, doch angesichts der schieren Masse und Komplexität der Problemstellungen eigentlich illusorisch ist.
So hält er nicht nur die aktuelle politische Klasse für völlig unfähig, da sie nur noch taktisch doch nicht mehr strategisch denken könne, die EU Konstruktionen auf politischer, fiskalischer und militärischer Ebene für völlig missglückt, und gleichzeitig die politischen Strukturen sowohl innenpolitisch in Bezug auf die bedrängte Demokratie als auch außenpolitisch im Hinblick auf die entstehende multipolare Weltordnung für höchst fragil.
Und wenn er dann ein ideales Deutschland als Heilsbringer imaginiert, das als „servant leader“ durch Führung „von hinten“ (um dem historische Misstrauen der europäischen Partnern gegenüber Deutschland zu begegnen), ergänzt durch Führung "von vorne", Europa durch die kommende Krisenzeit leiten und auf mirakulöse Weise alle diese monumentalen Probleme lösen soll, muss man tatsächlich unweigerlich an Dantes „Monarchia“ denken, der sich ganz ähnlich vergeblich einen idealen Monarchen erträumte, der die Welt ordnen und befrieden würde.
Europa
Allerdings kann man der harten Kritik Herfried Münklers an der Europäischen Union leider nur vollumfänglich zustimmen. Sie war in der Tat ein Produkt der „End of history“-Euphorie der 90er Jahre, als man sich in totaler Sicherheit wiegte und, mit durchaus edlen Motiven, sich in Orgien der Inklusion und Regulierung erging, die inzwischen zur großen Belastung für die Handlungsfähigkeit des Kontinents geworden sind.
Doch dass man unter der Führung Deutschlands alles einfach wieder revidieren könne, dazu gehört ein geradezu monumentaler Optimismus. Insbesondere jene sich in vielen Ländern auf dem Vormarsch befindenden nationalistischen Populisten, die vor allem eine Entmündigung durch Brüssel beklagen (was auch der Auslöser für den Brexit war) werden wohl kaum freiwillig Kontrolle ausgerechnet an den notorischen Besserwisser und Bürokratieweltmeister Deutschland abgeben.
Hinzu kommt, dass die Führungsrolle der USA in den vergangenen 80 Jahren auch einen homogenisierenden Effekt auf Europa hatte, und mit dem Rückzug der USA, der sich bereits seit Barack Obamas Präsidentschaft abzeichnete, aus rein gruppendynamischen Gründen Konflikte zwischen den europäischen Staaten wohl eher wieder zunehmen werden. Auch die historische Erfahrung zeigt, dass zerfallende Machtkonglomerate eher die Tendenz zur Auflösung als zur Reorganisation haben.
Dem steht gegenüber, dass, wie Münkler schon in seinem letzten Buch feststellte und in diesem Buch erneut betont, Europa eigentlich nur als ein mit einer Stimme und einer damit verknüpften kumulierten Machtbasis als eigenständiger Machtblock auf der globalen Weltbühne bestehen kann.
Es ist denn auch tatsächlich die erste der zentralen strategischen Fragen, die sich Deutschland stellen muss: will man diesen von Herfried Münkler skizzierten Weg einer Führung „von hinten“ gehen, und viel Energie in eine Reform und Moderation des EU Gebildes stecken. Oder erscheint nicht eigentlich eine Führung gänzlich „von vorn“ viel sinnvoller. Nämlich, dass Deutschland als eigenständiger Akteur vorangeht und dadurch sofort viel effektiver und unmittelbarer agieren und reagieren kann. Das je nach Sachlage internationale Koalitionen und Allianzen spinnt, und es am Ende den europäischen Partnern selbst überlässt, wer sich von ihnen Deutschland anschließen will und wer nicht.
Allianzen und Koalitionen
Unmittelbar damit verknüpft ist die schwierige Frage nach den Bündnissen, die Deutschland oder ein europäisches Gebilde mit anderen globalen Spielern sowie einzelnen Staaten in Zukunft auf wirtschaftlicher und militärischer Ebene eingehen sollte, und wie tief und fundamental, oder umgekehrt, wie pragmatisch und flexibel diese Bündnisse aussehen sollten.
Auch Herfried Münkler stellt in seinem Buch diese Frage, wohin sich Deutschland bzw. Europa in Zukunft orientieren soll, zu den USA oder Russland (wobei seine eigene Präferenz offensichtlich ist), oder ob es sich doch als unabhängiger Akteur etablieren sollte. Wahrscheinlich wäre er inzwischen sogar noch vorsichtiger, da uns gerade die ersten 100 Tage der neuen Trump-Administration brutal die Volatilität der neuen multipolaren Weltordnung vor Augen geführt haben.
Denn vielleicht können wir gar nicht mehr selbst entscheiden, ob wir zum amerikanischen Westen gehören wollen, wenn Donald Trump uns die Türe vor der Nase zuschlägt. Hinzu kommt, dass mit der zweiten Trump-Amtszeit in der amerikanischen Sicherheitspolitik neben der „Neo-Con“- und „Pivot-to-Asia“- Fraktion inzwischen noch eine weitere Fraktion von „Neo-Isolationists“ aufgetaucht ist, die lieber auf ihrem eigenen amerikanischen Kontinent (inklusive Kanada und Grönland) alleine glücklich werden wollen.
Russland und China
Seit dem zweiten Weltkrieg waren viele geostrategische Überlegungen der Amerikaner mit der eurasischen Allianz von Russland (bzw. der Sowjetunion) und China befasst, die immer wieder zum Ziel hatten, eben eine solche zu unterbinden. Münkler beschreibt denn auch die Entwicklung dieser Politik, jener historischen Allianz von Richard Nixon und Henry Kissinger mit China, die in den 90er Jahren von Zbigniew Brezinskis „The Grand Chessboard“ abgelöst wurde, der auf eine Fortsetzung dieser Politik unter neuen Vorzeichen drang, um ein wiedererstarktes Russland einzuhegen.
Der große historische Irrtum Brezinskis war (wie er kurz vor seinem Tod 2016 auch eingestand), dass nicht Russland wieder zur Großmacht aufstieg sondern China. Und dass man in der Fixierung auf Russland und dessen Einhegung durch die Nato-Osterweiterung das Gegenteil dieser eurasischen „Teile und herrsche“-Strategie bewirkt hatte, indem man Russland in die Arme Chinas trieb.
Dieser Richtungsstreit zwischen „Neo-Cons“ und „Pivot-to-Asia“-Anhängern, deren Trennlinien durch beide Parteien laufen, hat auch die Diskussionen der letzten Jahrzehnte im „Foreign-policy-establishment“ geprägt, wobei die „Neo-Con“-Fraktion bis in die Biden-Administration die Oberhand hatte. Während die „Neo-Cons“ das von ihnen selbst ausgelöste Dilemma durch eine „Double down“-Strategie zu lösen versuchten, indem sie den Druck an allen Fronten, d.h. gegenüber Russland, China und Iran erhöhten, hat sich inzwischen eine Furcht vor dem „overstretch“ breitgemacht, und damit ein verstärkter Einfluss der „Pivot-to-Asia“-Fraktion. Daher sieht man im Augenblick auch starke Versuche, die Konflikte in der Ukraine und Iran einzudämmen, um die Kräfte stärker in Asien zu bündeln. Trump scheint gar die Vorstellung zu haben, er könne Putin auf seine Seite ziehen.
Doch ist das große Dilemma von strategischen Entscheidungen ihre Trägheit und Gebundenheit. Insofern ist auch Brezinskis „Schachbrett“-Analogie durchaus zutreffend. Man kann seine Züge nicht einfach wieder rückgängig machen. Vielmehr ist ein Strategiewechsel mit einer mühsamen Reorganisierung der Figuren und diversen Opfern verbunden. So ist die Allianz zwischen China und Russland bereits zu weit fortgeschritten als dass sie kurzfristig wieder revidierbar wäre. Darauf muss man sich einstellen.
Großmachtängste und Einflusszonen
Im dritten Kapitel schreibt Herfried Münkler ausführlich über Deutschland als „Macht der Mitte“ und den historisch damit verbundenen „Einkreisungsängsten“, die oft als Faktor für die Eskalation zum ersten Weltkrieg angeführt werden. Man mag solche Ängste als irrational bezeichnen, doch sollte man sie trotzdem ernst nehmen, da sie, ebenso wie moralische, religiöse und ideologische Befindlichkeiten eine unleugbare Rolle für die kollektive Psyche einer Bevölkerung spielen.
Münkler merkt ganz richtig an, dass Russland keine „Einkreisungsängste“ haben muss. Tatsächlich hat es auf Grund seiner gänzlich anderen geographischen Ausdehnung und Bevölkerungsdichte stattdessen „Eindringungsängste“. In den letzten zwei Jahrhunderten wurde es von Napoleon und Hitler zweimal überrannt, und die deutschen Soldaten wieder aus dem Land zu vertreiben war mit einem ungeheuren Blutzoll verbunden. Russlands Drang nach Einflusszonen, die als Puffer dienen, nicht nur in Richtung Westen sondern auch in den Nahen Osten hinein, sind von diesen Erfahrungen getrieben.
Die USA wiederum muss als Kontinent, der von zwei Ozeanen flankiert ist, weder Einkreisungs- noch Eindringungsängste haben. Amerika scheint eher Ausgrenzungsängste zu haben, die auch historisch dafür sorgten, dass es in zwei Weltkriegen am Ende isolationistische Instinkte überwand und sich auf fremden Kontinenten involvierte.
Dass der kalte Krieg alles in allem so stabil blieb – man kann es nicht oft genug sagen, dass es eine der friedlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte war – lag gewiss nicht zuletzt daran, dass die Ängste aller Protagonisten adressiert wurden. Deutschland war in eine symmetrische westliche Allianz eingebunden, Russland hatte mit dem „Ostblock“ von der innerdeutschen Grenze an einen großen Puffer zum Westen, und die USA dominierten und führten die westliche Allianz. Konflikte entzündeten sich stattdessen in Korea und Vietnam in Proxy-Konstellationen, wo Amerikaner und Kommunisten unmittelbar aufeinander trafen.
Tatsächlich kann es auch heute nicht in Europas Interesse sein, eine durchgehende Nato-Grenze mit Russland zu haben. Denn das Prinzip der Abschreckung, das hinter der Nato-Doktrin steht, ist ein zweischneidiges Schwert. Der stabilisierenden Macht der Abschreckung steht immer auch die Gefahr einer großen Eskalation gegenüber (was auch exakt das Dilemma ist, das hinter den aktuellen Verhandlungen über Sicherheitsgarantien steht). Gerade weil es in so vielen russischen Grenzgebieten, so auch in der Ukraine und Georgien, auch ethnische und religiöse Konfliktpotentiale gibt, wäre das eine tickende Zeitbombe. Es ist auch im Interesse Europas wenn die Ukraine, Weißrussland und Georgien militärisch neutral bleiben und eine Pufferzone bilden.
Gewichtungen
Das Problem so vieler Diskussionen in deutschen Medien - sei es über ökonomische und geopolitische Themen oder über Migration und Klimawandel – ist, dass oft mit „gefühlten Wahrheiten“ operiert wird, die völlig von der numerischen Realität entkoppelt sind. Diesen Vorwurf muss man leider auch Herfried Münkler machen.
Um das zu verdeutlichen kurz einige ganz grobe Zahlen, die vor allem ein Gefühl von ungefähren Größenordnungen vermitteln sollen (im Detail können solche Vergleiche je nach Berechnungsgrundlage stark schwanken). In den letzten 10 Jahren ist das Bruttosozialprodukt der USA ungefähr doppelt so stark gewachsen wie das Europas, das Chinas fünf Mal so stark. Und China wächst im Moment in zwei Jahren etwa um das komplette Bruttosozialprodukt von Russland und in fünf Jahren um das komplette von Deutschland.
Meine größte Kritik an Münklers Buch besteht denn auch darin, dass er sich bei der Beschreibung der „Macht im Umbruch“ über hunderte von Seiten an Russland abarbeitet, dem unterstellt wird an einer europäischen imperialen Einflusszone „zwischen Lissabon und Wladiwostok“ zu arbeiten, während China vergleichsweise nur kursorisch Erwähnung findet.
Nimmt man als Maßstab strategischen Denkens den Blick auf die großen Linien und Entwicklungen, erscheint Münklers Blick auf die Welt völlig verfehlt. Denn im Kontext der Machtverteilung ist Russland ein Zwerg gegenüber den USA, China und Europa. Der große Trumpf, den Russland hat, ist seine Allianz mit China. Auf diese muss das geostrategische Augenmerk gerichtet werden, nicht auf die imperialen revisionistischen Fantasien russischer Politiker, die ohne jede Grundlage durch entsprechende Machtmittel sind.
Die größte Bedrohung für Deutschland und Europa ist denn auch nicht Russland sondern die Tatsache, dass wir wirtschaftlich gegenüber den USA und China immer mehr zurückfallen.
Historische Vergleiche
Diese verfehlte Wahrnehmung setzt sich auch in den historischen Vergleichen fort, die Herfried Münkler ausgiebig vornimmt. Denn in den Parallelen zum ersten und zweiten Weltkrieg setzt er das damalige Deutschland wiederholt mit dem heutigen Russland gleich.
Dabei ist vollkommen offensichtlich, dass im Verhältnis der Kräftegleichgewichte die heutige USA die Rolle einnimmt, die Anfang des 20. Jahrhunderts Deutschland spielte. Deutschland war damals die stärkste Wirtschaftsmacht Europas wie heute die USA die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt sind. Und Deutschland war von ähnlichen Abstiegsängsten getrieben, die sie aus Furcht vor dem Kontrollverlust irrationale Maßnahmen ergreifen ließen, was auch der Modus ist, der die aktuelle US-Administration umtreibt.
Herfried Münkler warnt durchaus zu Recht davor historische Vergleiche allzu wörtlich zu nehmen, da Geschichte sich allenfalls in Variationen wiederholt. Doch blickt man auf die ökonomischen Machtverteilungen in den großen Kriege der europäischen Geschichte, kommt man zu einem banalen Ergebnis. Am Ende gewann ohne Ausnahme immer die Seite, die mehr wirtschaftliche Macht kumulieren konnte. Auch in den beiden Weltkriegen gab letztendlich vor allem die Wirtschaftskraft der USA dem Lager der Alliierten das entscheidende Übergewicht. Alle Großmächte der Geschichte, wie zuletzt Frankreich unter Napoleon und Deutschland unter Hitler, scheinen an der simplen Rechenaufgabe zu scheitern, dass sie zwar mächtiger sind als alle anderen, doch nicht mächtiger als alle anderen zusammen. Diese Lektion muss auch Donald Trump noch lernen.
Deswegen muss auch die erste Überlegung aller militärischen und strategischen Erwägungen die nach den Verhältnissen der Wirtschaftskraft sein. Denn Krieg ist vor allem eines: ungeheuer teuer und verlustreich. Die zuvor skizzierten wirtschaftlichen Größenordnungen müssen die Grundlage bilden für alle strategischen Schritte Deutschlands und Europas.
Zweck des Ukrainekriegs
Im Kontext des Ukrainekriegs greift Herfried Münkler die Clausewitzsche Unterscheidung zwischen dem politischen Zweck eines Krieges und den militärischen Zielen, mit denen dieser Zweck erreicht werden soll, auf. Wer die zahlreichen Interviews mit Herfried Münkler in den letzten drei Jahren verfolgt hat, ist wenig überrascht, zu lesen, dass er Verfechter einer harten Linie gegenüber Russland ist, mit dem Zweck, dass man den Präzedenzfall einer gewaltsamen Grenzverschiebung nicht dulden darf, da sonst andere zu ähnlichen Vorhaben ermuntert würden.
Allerdings beschrieb Münkler bereits in seinem vorherigen Buch in aller Ausführlichkeit, dass es im multipolaren Moment, in dem wir uns jetzt befinden, keinen solchen Hüter des Völkerrechts mehr geben kann, womit dieser Zweck eigentlich obsolet wird. Umso mehr jetzt, da die Amerikaner unter Donald Trump sich noch demonstrativer von dieser Rolle des verantwortungsbewussten Weltpolizisten abwenden. Denn Europa alleine ist erst Recht nicht in der Lage, diese Rolle auszufüllen.
Gleichzeitig scheint Herfried Münkler die strategischen Ziele der USA nicht offen und transparent diskutieren zu wollen. Denn natürlich stand, wie bereits angedeutet, hinter der Nato-Osterweiterung bis zur Ukraine und Georgien, die vor allem von der Regierung von George W. Bush mit den „Neo-Con“-Falken Dick Cheney und Donald Rumsfeld voran getrieben wurde, durchaus ein nachvollziehbarer geostrategischer Zweck, nämlich möglichst viele ehemalige Ostblock-Länder auf die Seite des Westens zu ziehen, um damit ein Bollwerk gegen ein wiedererstarktes Russland zu schaffen und zugleich mehr Einfluss über das Schwarze Meer und den westlichen Nahen Osten zu bekommen.
Und man sollte auch offen einräumen, dass diese Strategie aus Sicht Deutschlands und Westeuropas durchaus erfolgreich war. Wären die Ostblock-Länder im östlichen Orbit verblieben und heute Teil einer autoritären Allianz, die von Polen bis China reicht, müsste man sich noch viel mehr Sorgen machen. Das aktuelle europäische Bündnis aus EU, Nato und weiteren demokratischen Verbündeten ist dagegen ökonomisch und an Bevölkerung Russland so klar überlegen, dass die viel beschworenen Gefahren eigentlich irrational sind.
Für Europa bleibt die Frage, ob man sich, nach dem sich immer stärker abzeichnenden Rückzug der Amerikaner, die ursprüngliche amerikanische hegemoniale Strategie zu eigen machen sollte. Das heißt zusammen mit dem Nato-Partner Türkei auf eigene Rechnung den Einfluss ins Schwarze Meer und den Nahen Osten auszubauen und gegen den Widerstand Russlands gewaltsam die Ukraine und Georgien in den westeuropäischen Orbit zu integrieren.
Jeder, der sich die damit verbundenen Kosten und Risiken vor Augen führt, kann diese Frage nur mit einem klaren Nein beantworten. Und es bleibt mir ein Rätsel, warum ein so kluger Mann wie Herfried Münkler nicht sieht, welch katastrophale Folgen es für Deutschland und Europa hätte, diesen Pfad weiter zu verfolgen.
Denn der Glaube der Militärstrategen, die dies befürworten, man könne durch fortlaufende finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine am Ende Russland langfristig noch niederringen, verkennt, dass im aktuellen hegemonialen Schachspiel Russland für China - nicht nur militärisch sondern fast noch mehr auf Grund seiner enormen Rohstoffvorkommen, die für viele Technologien der Zukunft eine Schlüsselrolle spielen - eine viel zu wertvolle Figur ist, als dass es diese opfern würde. Europa ist schlicht und einfach ökonomisch nicht mehr mächtig genug, es mit China in dieser Beziehung in einem Kräfteringen aufzunehmen.
Noch schlimmer wäre eine militärische Eskalation durch den Eintritt der Nato. Denn die gewaltigen militärischen Mittel, die durch die Kriegsparteien involviert wären, würden zu einem unvorstellbaren Ausmaß an Zerstörung führen. Und wie in allen großen hegemonalen Konflikten der Vergangenheit würde die Eigendynamik der Eskalation direkt in die „Thukydides-Falle“ und zu einem Weltkrieg führen.
Deutschlands und Europas Perspektiven
Vielleicht ist es eine Generationenfrage, dass Herfried Münkler, ähnlich wie Peter Sloterdijk in seinem letzten Buch, im Wunsch einer Kontinuität und Bewahrung der europäischen Kultur von einem „comeback“ Europas als Führungsmacht auf der Weltbühne träumen. Beide sind in einer Zeit aufgewachsen, in der europäische Kultur noch Weltgeltung hatte und europäische Geschichte noch die Geschichte der Welt war. So sehr ich auch selbst an der europäischen Kultur hänge, ich halte das für illusionär.
Deutschland sollte seine Rolle im neuen globalen Kräftegleichgewicht akzeptieren. Man ist keine Weltmacht mehr wie vor 150 Jahren und auch kein Alliierter der Weltmacht mehr wie vor 50 Jahren. Die USA und China werden die geopolitischen Geschicke der Zukunft bestimmen und wir werden Donald Trump und Xi Jinping sowie ihre Nachfolger leider nicht von ihren Taten abhalten können, so irrational sie auch sein mögen. Doch müssen wir ihnen auch nicht folgen, wenn es nicht in unserem Interesse ist.
Das Gebot der Stunde ist Pragmatismus. Man sollte mit dem Gewicht, das man durchaus noch hat, sorgsam umgehen und sich vor allem darauf fokussieren, wirtschaftlich nicht noch weiter zurückzufallen. Denn je weiter man zurückfällt, desto mehr wird man zum Spielball der Großmächte. In dieser Position besteht eine kluge Strategie eher im Reagieren als im Agieren, da man die volatilen Bewegungen der multipolaren Ordnung nur noch sehr bedingt beeinflussen kann.
So bitter und demütigend es ist, man sollte sich die Niederlage in der Ukraine eingestehen (denn das ist es der militärischen Lage nach), und in einem Friedensabkommen vor allem eine europäische Sicherheitsarchitektur anstreben, die um die aktuellen Grenzen ein stabiles militärisches Gleichgewicht herstellt, das beiden Seiten Sicherheit gibt. Europa muss in diesem Kontext auch weiter aufrüsten um sich von den USA unabhängiger zu machen. Doch ist eben so wichtig dabei das rechte Maß zu finden, denn wenn es auf Kosten der ökonomischen Prosperität geht wird das Europa langfristig noch stärker schwächen.
Herfried Münkler geht in seinem Buch auch auf Völkerrecht, internationale Institutionen, Werte der Aufklärung und moralische Imperative ein. Doch scheint ihm nicht klar zu sein, dass Macht die primäre Kraft ist und alles, was man mit dieser Macht an positivem oder negativem bewirken kann, ohne diese Macht Schall und Rauch ist. Schon Thukydides wusste: die Mächtigen tun, was sie wollen, die Schwachen erleiden, was sie müssen. Gerade wer eine freie und gerechte Gesellschaft erhalten will, muss zuerst auf die Parameter der Macht schauen, und bei deren aktuellem "Umbruch" dessen Gleichgewichte im Auge behalten.
Auch im Schachspiel ist der Schlüssel zum Erfolg, sich genau über die Stärke der eigenen Figuren und deren Stellung im Klaren zu sein. Deutschland hat im 20. Jahrhundert schon zwei Mal seine eigene Stärke überschätzt, und ist daran furchtbar gescheitert. Das sollte uns nicht noch ein drittes Mal passieren.
Bild credit: Rohwolt Verlag
Verwandte Artikel: