Markus Brechtken - Aufarbeitung des Nationalsozialismus: Ein Kompendium
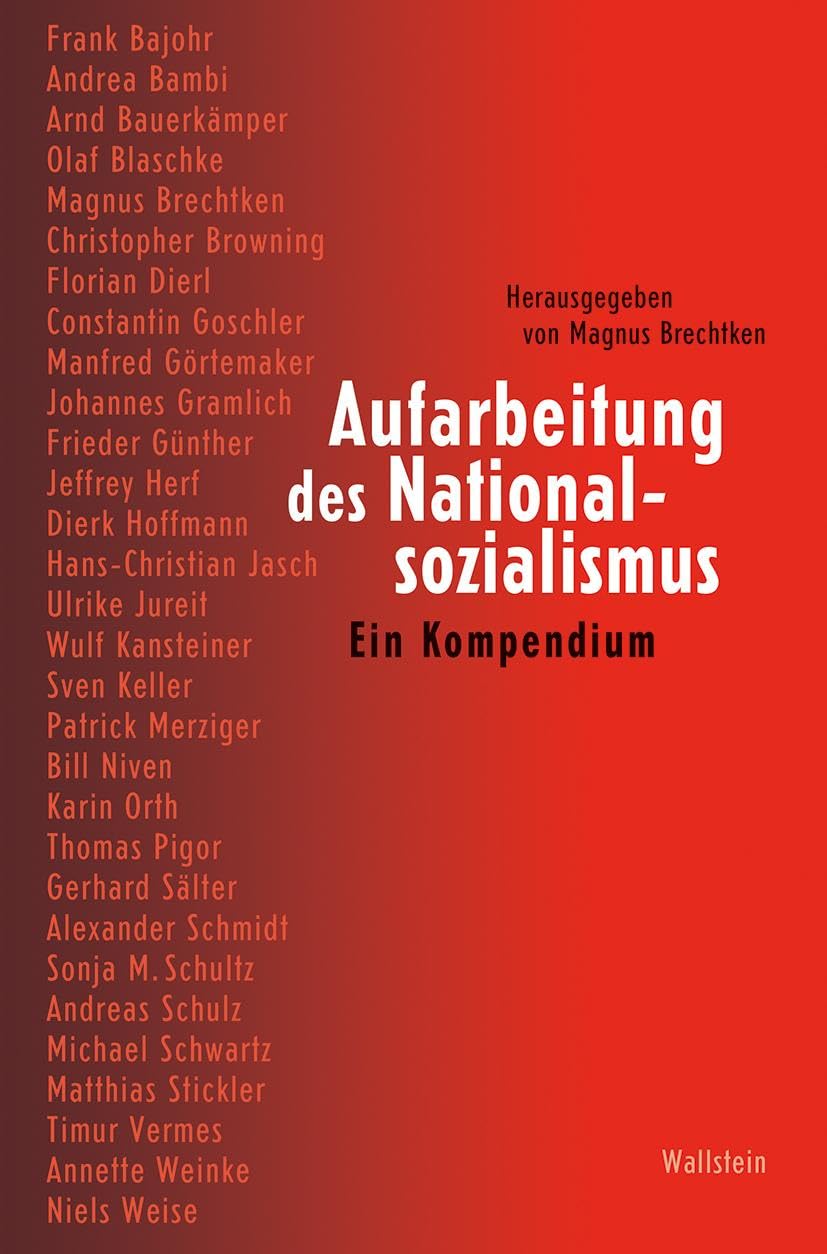
Historisch zeigt Gramlich auf, wie die Nazis die Juden entrechteten und eine spezifische Bürokratie Stück für Stück enteigneten, auch indirekt über Auswanderungssteuern. Das so geschaffene Überwachungsnetz, das auch massiv auf Denunziation basierte, ermöglichte eine präzise Feststellung jüdischen Vermögens. In den späteren Expansionen des Regimes ging diese Bürokratie dann viel ungehemmter und direkter vor; in Osteuropa wurde zudem auch aller staatlicher und privater, nicht "nur" jüdischer, ausgeplündert. Die Restitution nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von den Alliierten von Anfang an betrieben, im Osten allerdings nur auf staatlicher Ebene. Schwieriger blieb die innerdeutsche Restitution, die zudem (ein Leitmotiv) von den Behörden absichtlich hintertrieben wurde, um möglichst schnell einen "Schlussstrich" zu erreichen. Die Wende in der Aufarbeitung der NS-Zeit in den 1990er Jahren führte dann zu einer neuen Restitutionswelle, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist.
Andrea Bambi befasst sich in Kapitel 27, "Kunstraub, Restitutionsfragen und Provenienzforschung. Historische Perspektiven einer verzögerten Aufarbeitung", vertiefter mit der Metaebene dieser Restitutionswelle, indem sie aufzeigt, wie die Forschung vorging und vorgeht, welche Desiderate bestehen und in welchen Datenbanken die entsprechenden Informationen sind. Angesichts dessen, dass in 255 Museen rund 21 Millionen Fundstücke lagern, die jeweils Monate der Recherche benötigen und es insgesamt kaum 30 Forschungsstellen gibt, ist hier noch auf lange Zeit Forschungsarbeit zu leisten. Die öffentliche Wahrnehmung unterliege währenddessen einem ständigen Wandel, den Bambi an einigen Beispielen deutlich macht.
Abschnitt 9, "Kontroversen vor der Gegenwart", befasst sich schließlich mit aktuellen Diskussionen.
Bill Niven stellt in Kapitel 28, "Jüngere Strömungen deutscher Erinnerungskultur - einige Beobachtungen", einige Thesen zu aktuellen Diskussionen in der Debatte auf. So postuliert er, dass wir uns in einer "post-moralistischen" Phase der Erinnerung befänden, die davon gekennzeichnet sei, dass zunehmend dezentral und weniger von klaren Aufklärungsgesten geprägt erinnert werde; besonders die Stolpersteine hebt Niven hier positiv heraus und grenzt sie vom seiner Ansicht nach bereits beim Bau "überholten" Holocaust-Mahnmal in Berlin ab. Niven lässt eine generelle Zuneigung zu solchen Diskursen erkennen, die eher in dem Sinne revisionistisch sind, als dass sie frühere deutsche Schulddebatten komplett ausblenden. So lobt er etwa "Unsere Mütter, unsere Väter" dafür, dass polnischer Antisemitismus so unbefangen kritisiert werde, während gleichzeitig Auschwitz keine Rolle spiele. Ich konnte mit seinen Thesen eher wenig anfangen, auch wenn ich ihnen zu Teilen durchaus zustimmen kann.
Abschnitt 10, "Kleinkunst und Literatur: Zwei Interviews", stellt dann zwei von Markus Brechtken geführte Interviews an den Abschluss des Bandes.
Das erste Interview mit Thomas Pigor, Kabarettist und Stimme Hitlers in Walter Moers "Bonker", in Kapitel 29, ""...eine geradezu blasphemische Freude, dem Moloch ans Bein zu pinkeln..."", lässt Pigor seine Herangehensweise an eine kabarettistische Verwertung Hitlers reflektieren. Wenig überraschend äußert er sich positiv und sieht in der ironischen Brechung eine wertvolle Perspektive; zudem betrachten Pigor und Brechtken die Geschichte kabarettistischer Verwertung und die Kontextabhängigkeit solcher Scherze.
Das zweite Interview mit Timur Vermes, dem Autor von "Er ist wieder da", in Kapitel 30, ""Das ist entsetzlich - und komisch."", dreht sich engmaschiger um Vermes eigenen Zugang zu Hitler. Er verteidigt seine Konzeption, aus der Ich-Perspektive einen "heutigen" Hitler abzubilden, und sieht sein 2011 erschienenes Buch im Großen und Ganzen immer noch als aktuell. Vorwürfe einer Verharmlosung weist er zurück.
---
Ich muss zugeben, ich habe mich lange vor dem Band gedrückt. Er lag prominent auf meinem Stapel der Schande, aber die Frage, ob ich wirklich 680 eng bedruckte Seiten zur NS-Aufarbeitung lesen will, kam dann noch immer mit einem entschlossenen "eh, vielleicht später" zurück. Brechtkens Einleitung mit ihrer Kritik an Relativierung reizte mich dann auch direkt zum Widerspruch, weil sie mir andere Perspektiven etwas zu schnell auszuschließen und den potenziellen Diskurskorridor zu stark zu verengen schien. Die Auswahl der Autor*innen und der Beiträge zeigt das natürlich auch ein wenig auf; gleichzeitig kann man Brechtken kaum vorwerfen, dass hier ein einseitige Präsentation passieren würde. Aber Diskurse wie Zimmerers Kolonialisierungs-These oder die Katechismusdebatte werden wenn überhaupt nur kritisch aus der Außenperspektive gestreift und finden keinen Eingang in den Band; Brechtken et al stellen sie ziemlich klar außerhalb des satisfaktionsfähigen Konsens'. Ich bin kein Forscher mit einem Schwerpunkt im Gebiet, weswegen ich mir eine Bewertung hier verbiete, es fiel mir nur auf.
Ein Begriff, den ich erst durch Bauernkämpfers Beitrag lernte und sehr schätze, ist "Sühnestolz". Er beschreibt gut das Spannungsfeld, in dem die deutsche Vergangenheitspolitik sich bewegt und mit dem sich ja einige der Autor*innen hier auseinandersetzen. Auf der einen Seite ist und bleibt die deutsche Vergangenheitspolitik in meinen Augen die beste weltweit, worauf man zurecht stolz sein kann; gleichzeitig hat sie natürlich ihre blinden Flecken und neigt dazu, kategorisch bestimmte Sichtweisen vorzugeben und manchmal auch selbstgefällig zu befinden, dass man alles richtig gemacht habe. Gleichzeitig aber tun wir es trotz aller Defizite. Für mich ist der Begriff deswegen nicht ganz so negativ besetzt wie für Bauernkämpfer.
Eine Emotion, die vor allem in den frühen Kapiteln des Bandes immer wieder in mir hochkam, ist Wut. Ich wusste natürlich schon vorher, dass die Vergangenheitsaufbearbeitung ein vergleichsweise zeitgenössisches Phänomen ist und vor allem in der Adenauer-Ära ein...anderes Verhältnis zur NS-Vergangenheit herrschte. Es macht mich aber immer noch jedes Mal wütend, wie man lange die Verantwortung geleugnet hat und wie gezielt einerseits klaren Tätern geholfen wurde, sich reinzuwaschen, und zu allem Überfluss auch noch auf die Opfer eingeschlagen wurde. Das ist wahrlich kein Ruhmesblatt der Republik.
Eine Frage, die viele der Kapitel für mich immer aber trotzdem immer wieder aufwarfen: War der Schlussstrich richtig? Denn letztlich ist schwer vorstellbar, dass eine Aufarbeitung, wie wir sie seit den 1990er Jahren betreiben, überhaupt möglich gewesen wäre, solange die ganzen Täter*innen nicht schon überwiegend tot oder doch wenigstens der Entscheidungssphäre entzogen waren. Die Deutschen hatten sich so umfassend schuldig gemacht, dass eine solche Aufarbeitung wahrscheinlich einem kalten Bürgerkrieg gleichgekommen wäre. Ich bin, quasi als vorläufige Arbeitshypothese, weil die Frage im Buch nicht gestellt wird, bei folgender Überlegung: ein grundsätzlicher Schlussstrich war unvermeidbar, allerdings ging die junge BRD an einigen Stellen wesentlich zu weit und deutlich über das notwendige Maß hinaus. Dieser Schlussstrich auf allen Ebenen entsprach einer Entrechtung der Opfer. Die BRD erreichte damit bei ihnen genau den Effekt, den sie bei den Täter*innen zu vermeiden suchte; wahrlich kein Ruhmesblatt.
Das zeigt sich auch im direkten Vergleich mit der DDR. Nicht, dass die eine mustergültige Politik betrieben hätten, aber sie waren zumindest an einigen Stellen entschlossener und konsequenter als die BRD. Die in den entsprechenden Beiträgen aufgeworfene Frage, ob dies zu institutionellen Dysfunktionalitäten signifikanten Ausmaßes geführt hat, wäre wirklich eine, die in meinen Augen dringend beantwortet und beforscht werden sollte. Generell ist der starke Fokus auf die BRD noch eine Schwäche des Bandes, der aber auch dem Forschungsstand geschuldet ist: die Forschung am Umgang mit der NS-Vergangenheit in der DDR steckt ja noch in ihren Kinderschuhen, da ist viel komparative Arbeit zu leisten, was uns eventuell für die Zukunft und den weiteren Umgang neue Erkenntnisse an die Hand geben kann.
Da in Baden-Württemberg zur Zeit die Lektüre von Katharina Hackers Roman "Die Habenichtse" verpflichtender Abiturstoff ist, der sich unter anderem um Restitutionsansprüche der Nachkommen jüdischer Opfer und die damit verbundenen Gerechtigkeitsfragen dreht, habe ich die Kapitel zur Restitution mit einer großen Neugierde gelesen. Ich finde es faszinierend, wie hier mit der kleinteiligen Logik des Rechtsstaats Stück für Stück Gerechtigkeit zu schaffen versucht wird und wie unbefriedigend und unvollständig diese Versuche zwangsläufig bleiben müssen - und wie wichtig sie dennoch sind.
Insgesamt war die Lektüre des Bands für mich sehr lohnenswert. Wer sich für die Materie interessiert, wird in diesem Kompendium sicherlich eine gute Übersicht finden.
Dir gefällt, was Stefan Sasse schreibt?
Dann unterstütze Stefan Sasse jetzt direkt:
